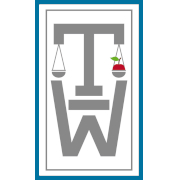Nahezu jeder Unternehmer, der nicht mit einem reinen Vorkassemodell arbeitet, hat irgendwann den Fall, dass ein Kunde seine Rechnung nicht bezahlt. Dann stellt sich die Frage, wie man die Forderung durchsetzt, denn verzichten möchte man auf das Geld in aller Regel nicht.
Inhouse Durchsetzung
Wird die Rechnung nicht bezahlt, sollte zunächst eine Mahnung verschickt werden, denn mitunter handelt es sich bei der Nichtzahlung wirklich nicht um böse Absicht, sondern die Rechnung ist nicht angekommen, verloren gegangen, vergessen worden oder der Kunde ist einfach unglaublich schlecht oder langsam organisiert.
Spätestens mit der Mahnung wird der Kunde außerdem in Verzug gesetzt. Befindet der Kunde sich im Verzug, muss er die weiteren Kosten der Forderungsdurchsetzung, also in der Regel Anwalts- oder Inkassokosten, erstatten. Im Falle einer erfolgreichen Durchsetzung entstehen für den Unternehmer (Gläubiger) also keine Kosten.
Natürlich können auch die weiteren Tätigkeiten inhouse erledigt werden, die Kosten für die Mitarbeiter werden allerdings nicht ersetzt und in der Regel sind die Mitarbeiter auch nicht tiefergehend juristisch ausgebildet, um die Sachverhalte in Zweifelsfällen bewerten zu können.
Inkassobüro
Inkassobüros kaufen dem Gläubiger die Forderung entweder ab oder sie treiben sie im Namen des Gläubigers ein. Der Forderungsverkauf lohnt sich in der Regel nicht, da das Inkassounternehmen nur einen mehr oder weniger hohen Prozentsatz der Forderung bezahlt, um selbst daran zu verdienen.
Bei der Forderungsdurchsetzung setzen Inkassounternehmen teilweise bedrohlich klingende Mahnschreiben, zunehmend auch E-Mails. Weniger seriöse Unternehmen drohen dabei gerne mit der Schufa, rufen dauernd an oder machen gar Hausbesuche. Häufig dauert ein Inkassoverfahren sehr, sehr lange, weil nicht nur ein oder zwei Inkassoschreiben verschickt werden, sondern über Monate ein Schreiben dem nächsten folgt.
Dies wissen auch viele Schuldner und nehmen die ersten Inkasso schreiben daher nicht besonders ernst, sprich reagieren nicht darauf. Dadurch verzögert sich die Zahlung im Durschschnitt.
Als letztes Mittel bleibt dem Inkassounternehmen das gerichtliche Mahnverfahren. Legt der Schuldner hier jedoch Widerspruch gegen den Mahnbescheid oder Einspruch gegen den Vollstreckungsbescheid ein, ist Schluss mit der inkassotätigkeit. Dann gibt das Inkassounternehmen den Fall zurück bzw. an einen Anwalt.
Durchsetzung durch einen Anwalt
Es mag so aussehen, als würde man mit Kanonen auf Spatzen schießen, aber letztlich erbringt der Anwalt zunächst die gleiche Dienstleistung wie ein Inkassounternehmen und auch der Preis ist in meist gleich, da auch Inkassounternehmen in aller Regel nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz abrechnen.
Im Gegensatz zum Inkassobüro wird ein Anwalt allerdings je nach Fall maximal ein bis zwei Mahnungen an den Schuldner schicken, denn Anwälte und ihre Fachangestellten verdienen pro Stunde natürlich mehr, als ein angelernter Sachbearbeiter eines Inkassounternehmens. Folglich haben sie keine Zeit für sinnlose Schreiben. Außerdem werden auch kleine Fälle in den meisten Anwaltskanzleien in der Regel zunächst auf ihre Erfolgsaussichten geprüft. So werden Fälle, bei denen der Kunde im Recht ist vorab aussortiert und nicht weiter verfolgt bzw. dem Unternehmer zur weiteren Klärung zurückgegeben. Dies schützt auch den guten Ruf des Unternehmens, denn nichts zerstört eine Kundenbeziehung nachhaltiger als unberechtigte Forderungen.
Unbestrittene Forderungen werden auch vom Anwalt zunächst im gerichtlichen Mahnverfahren verfolgt. Wird der Schuldner jetzt aktiv und legt Widerspruch oder Einspruch ein, kann der Anwalt den ihm schon bekannten Fall direkt in einem Gerichtsverfahren weiterverfolgen, wobei er im Regelfall vorab mit dem Auftraggeber nochmals die Erfolgsaussichten und die Wirtschaftlichkeit eines solchen Verfahrens erörtern wird.
Ist eine Forderung schon außergerichtlich gegenüber dem Gläubiger oder dem Anwalt bestritten worden aber die Erfolgsaussichten sind gut oder der Mandant möchte den Anspruch trotzdem weiterverfolgen, wird der Anwalt je nach Fall ebenfalls zunächst ein gerichtliches Mahnverfahren durchführen oder aber zur weiteren Beschleunigung des Verfahrens direkt Klage erheben.
Ist entweder die Klage oder das gerichtliche Mahnverfahren abgeschlossen, übernimmt der Anwalt im Normalfall auch die weitere Vollstreckung und beauftragt dafür einen Gerichtsvollzieher mit konkreten Maßnahmen, z.B. Gehaltspfändungen, Kontopfändungen, etc.
Aus dem geschaffenen Vollstreckungstitel kann nun 30 Jahre lang vollstreckt werden. In dieser Zeit kommen zwar nicht alle, aber viele Schuldner irgendwann wieder zu Geld. Hartnäckigkeit zahlt sich aus.
Fazit
Wenn Sie schnelles Geld brauchen oder windige Forderungen haben, kann ein Verkauf an ein Inkassounternehmen sinnvoll sein.
Ansonsten geben Sie den Fall lieber einem Anwalt Ihres Vertrauens, der den Fall von Anfang bis Ende für Sie verfolgt und dabei mit Augenmaß und Rücksicht auf den guten Ruf Ihres Unternehmens vorgeht. Im Idealfall haben Sie außerdem einen direkten und kompetenten Ansprechpartner, der auch für Rückfragen greifbar ist und Hand in Hand mit Ihrer Buchhaltung/Forderungsabteilung arbeitet.
Gerne unterstütze ich auch Sie bei der Durchsetzung offener Forderungen. Egal, ob es nur eine einzelne Forderung oder ein regelmäßiges Aufkommen eventuell auch kleinerer Forderungen ist, jeder Fall wird individuell geprüft. Ob Sie den Fall dabei völlig aus der Hand geben möchten und mir weitgehende Freiheit bei Ratenzahlungen und Vergleichsverhandlungen einräumen, oder ob Sie in jedem Fall engmaschig informiert werden möchten, um selbst die Entscheidungen zu treffen, bleibt dabei Ihrem Geschmack überlassen und kann nach Belieben gehandhabt und jederzeit geändert werden.
Bei Interesse kontaktieren Sie mich einfach unverbindlich per E-Mail: wenck@rechtsanwalt-wenck.de, mobil unter 015156068110 oder über Festnetz 04179 7509820.
Ihr Rechtsanwalt
Thiemo Wenck