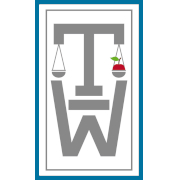Wer Tickets für die 2023 bis 2025 ausgefallenen Hansi Hinterseer- und Stimmen der Berge-Konzerte des Veranstalters Promevent & Media KG hat, kann weiterhin sein Geld zurückbekommen, wobei die Erfahrung zeigt, dass ohne energische anwaltliche Durchsetzung von Seiten des Veranstalters keine Reaktion erfolgt. Bei Konzerten aus 2020-2022 sieht es hingegen schlecht aus, hierzu unten mehr.
Insbesondere bei der Einforderung der Erstattung der Ticketpreise bei Promevent für die folgenden Veranstaltungen können wir Sie unterstützen:
Hansi Hinterseer: Celle 05.06.2023, 11.03.2024
Hansi Hinterseer: Emsdetten 04.06.2023, 10.03.2024
Stimmen der Berge: Weiden in der Oberpfalz 22.09.2024
Stimmen der Berge: Bad Neustadt an der Saale 22.02.2025
Wir haben bereits eine Vielzahl von Ticketinhabern gegen Promevent erfolgreich vertreten oder sind noch dabei. Sie können uns gerne unter promevent@rechtsanwalt-wenck.de kontaktieren, wenn wir auch Ihren Fall übernehmen sollen. Die anfallenden Kosten sind in der Regel von Promevent zu erstatten und werden im Regelfall auch von einer privaten Rechtsschutzversicherung gedeckt.
Die Fallbearbeitung läuft wie folgt ab:
0. Sie sollten die Rückzahlung unter Übersendung der Originaltickets, des Erstattungsantrages und eines Anschreibens mit Fristsetzung per Einwurf-Einschreiben (kein Übergabe-Einschreiben, diese werden unserer Erfahrung nach nicht zugestellt und nicht bei der Post abgeholt) an die Promevent & Media KG, Nadorster Straße 30, 26123 Oldenburg gesendet haben, das Schreiben sollte angekommen sein (Sendungsverfolgung) und die Zahlungsfrist sollte abgelaufen sein. Scannen Sie alle Unterlagen vor dem Versand ein oder machen Sie gut lesbare Fotos.
1. Sie kontaktieren uns per E-Mail an promevent@rechtsanwalt-wenck.de. Nach Möglichkeit sollten Sie die folgenden Unterlagen beifügen:
a) Fotos/Scans aller Tickets
b) Foto/Scan des Erstattungsantrags
c) Foto /Scan des Anschreibens mit dem Sie unter Fristsetzung oder unverzüglich zur Zahlung aufgefordert haben
d) Sendungsverfolgungsnummer des Einwurf-Einschreibens (kein Übergabe-Einschreiben, diese werden unserer Erfahrung nach nicht zugestellt und nicht bei der Post abgeholt) mit dem Sie die Forderung mit Übersendung der Tickets, des Erstattungsantrags und des Anschreibens bei Promevent geltend gemacht haben oder ein Screenshot der entsprechenden Sendungsverfolgung.
2. Wir prüfen kostenfrei, ob alle Unterlagen vorliegen und ob die Voraussetzungen dafür vorliegen, dass Promevent Ihre Anwaltskosten erstatten muss, sofern wir tätig werden. Sollte noch etwas fehlen oder Sie noch etwas tun müssen, informieren wir Sie entsprechend.
3. Sobald alle Unterlagen vorliegen, erhalten Sie von uns die Mandatsunterlagen per E-Mail und senden diese gescannt zurück, um den Auftrag zu erteilen.
4. Wir versenden ein außergerichtliches Aufforderungsschreiben an Promevent. Sofern die Zahlung erfolgt, leiten wir das Geld an Sie weiter, erfolgt keine Reaktion, informieren wir Sie über die weiteren möglichen Schritte.
Das Zahlungsverhalten von Promevent war in der Vergangenheit wechselhaft, so dass in vielen Fällen eine außergerichtliche Zahlung erreicht werden konnte, in etlichen Fällen aber auch ein gerichtliches Vorgehen und teilweise sogar eine Zwangsvollstreckung erforderlich geworden sind. Spätestens in der Zwangsvollstreckung haben wir (Stand 17.12.2025) jedoch stets die komplette Forderung des jeweiligen Mandanten durchsetzen und ihm den Ticketpreis nebst Zinsen auszahlen können. Mitunter ist aber Geduld gefragt. Auch wenn die Forderungen meist „nur“ bei 100-300 € liegen, lohnt es sich also in der Regel, die Sache nicht auf sich beruhen zu lassen und dem Veranstalter das Geld zu „schenken“.
Die Ansprüche für ausgefallene oder verschobene Konzerte des Veranstalters aus den Jahren 2020-2022 verjähren allerdings mit dem Jahreswechsel 2025/2026, so dass die Ansprüche dann wertlos werden. Wer noch solche Tickets hat, sollte noch vor dem Jahreswechsel zu einem Anwalt gehen (oder selbst tätig werden) und die Ansprüche vor Jahreswechsel einklagen oder einen Mahnbescheid beantragen, um die Verjährung zu hemmen. Wir nehmen diese Fälle nicht mehr an, da wir eine zuverlässige und die Verjährung hemmende Bearbeitung vor Jahreswechsel nicht gewährleisten können.